Auer Dult
|
|
jetzt fasziniert mich schon tagelang dieser Name. Ein großer Warenmarkt mit Kirmes, dreimal im Jahr für jeweils 9 Tage auf dem Mariahilfskirchplatz im Münchner Stadtteil Au. Ähnlich wie: es gibt sie noch, die guten Dinge, aber quasi zu Erzeuger- und nicht zu diesen verrückten Manufactum-Preisen, die ja nur für die kaputten Leute plausibel sein können, die von der Herstellung einer Sache total entkoppelt abgeschnitten sind, die zuviel Geld haben, die so gern schwelgen in den von Manufactum für sie aufbereiteten einfachen reinen ehrlichen Klosterwelten der guten Hände und Herzen Arbeit, weil sie selber so grundunrein und rettungslos verdorben sind.
Eine Dult ist im bairischen Sprachraum von der ursprünglichen Bedeutung her ein „Kirchenfest“. (Althochdeutsch tuld „Fest, Feier; Jahrmarkt“[1], mittelhochdeutsch tult, dult auch: „Kirchenfest“[2]. Das Wort stammt vermutlich aus dem Gotischen und bedeutete dort so viel wie „ausgelassenes Fest“.) (…) Die Jakobidult wurde erstmals im Jahr 1310 am Anger, dem heutigen Sankt-Jakobs-Platz veranstaltet. Von 1791 an fand sie in der Kaufinger-/Neuhauser Straße statt. Im Jahr 1796 verlieh Kurfürst Karl Theodor dem Münchner Vorort Au östlich der Isar das Recht, zweimal jährlich eine Dult abzuhalten. Aus dieser Zeit stammt der Name Auer Dult. Seit 1905 findet die Dult mit Ausnahme der Kriegs- und Nachkriegsjahre 1943-1946 dreimal im Jahr statt.
wir sollten dort zeichnen, aber ich kann es ja nicht, es war sehr frustrierend und schnell gab ich auf, ich suchte mir auch extra schwere Perspektiven aus, in der Kirche zur Mittagsmeditation, Seitenraum, hinter Gittern ein hellgrauer Metall-Kasten mit Wölbung, den ich nicht erriet, davor ein Holzregal hochkant mit roten Gesangbüchern drin, aus denen Strippen heraushingen. Ich habe selbst gedacht, wenn man möglichst stumpfsinnig versucht nur zu zeichnen, was man sieht, also nicht schon zusammengesetzt, sondern isoliert Detail an Detail reiht, da müßte doch eigentlich automatisch eine gute Zeichnung herauskommen.
Was leider nicht der Fall war. Statt gut behindert Nur verhockt.
Dann ging ich hinaus und kaufte eine emaillierte Vierkantpfanne der Firma Krüger aus Ahlen, innen blau außen schwarz, 9.50,- eine Topfbürste mit Gesicht für 2 Euro und 3 Meter gut erhaltenes Leintuch, 60 Jahre alt aus einer Wäschemangel für 15 Euro. Ab und zu sah ich die anderen, die irgendwo standen oder saßen und zeichneten und das war ein Anblick reinsten Glücks.
Die Auer Maidult geht noch bis Sonntag.
Am Zeichnen muß man länger dranbleiben.
Wie grün die Isar ist!
Es ist alles wahr!
__________________________________
4.5.10
.
je erschöpfter ich werde wird ´s besser, da hat man keine Kraft mehr sich zu verstellen
____________________________________________


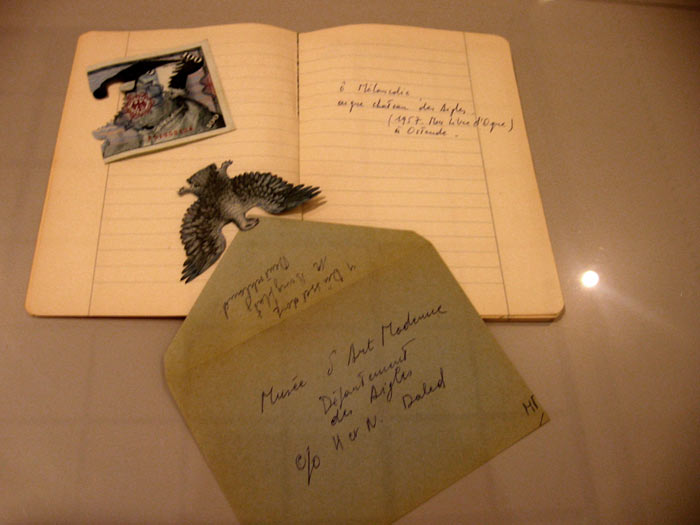
Am 28. April 2010 um 00:44 Uhr
Aus der Förg-Klasse dringt „Kayleigh“
Am 4. Mai 2010 um 23:00 Uhr
http://www.lyrikkritik.de/Stolterfoht%20-%20Avantgarde.html
„Die Evidenzen, um die es der experimentellen Lyrik geht, sind aber immer binnensprachliche Evidenzen, ein Nachdenken der Sprache über sich selbst, und das, was im Gedicht an Welt zum Vorschein kommt, bleibt immer als sprachlich konstruiert erkennbar. Denn wie wäre Welt, auch außerhalb des Gedichts, anders denkbar als sprachlich konstruiert und konstituiert; und das, was allenthalben als ein Manko der experimentellen, auf sich und die Sprache bezugnehmenden Lyrik betrachtet wird, wäre in Wahrheit ihr großer Vorzug: die Dinge so zu nehmen und zu behandeln, wie sie gegeben sind: sprachlich. Dies ist der eine wesentliche Unterschied zwischen experimentellen (also eigentlich realistischen) und konventionellen Gedichten. Der zweite folgt daraus und besteht darin, dass experimentelle, „ausprobierende“ Texte in besonderer Weise dazu geeignet scheinen, mit dem Sinnbefund „Verständnis- und Erkenntnisanalyse“ produktiv umzugehen.
Wenn es richtig ist, dass wir mit „Verstehen“ und „Erkennen“ keine vor- oder nebensprachlichen Phänomene meinen, sondern genuin sprachliche, und zwar sowohl was den Prozess des Verstehens und Erkennens selbst betrifft, als auch bezüglich ihrer Inhalte (was immer das sein mag – womöglich wieder nur das Verstehen und Erkennen), dann scheint es mir auf der Hand zu liegen, dass in Gedichten, denen diese Einsicht zugrunde liegt, kaum noch zu unterscheiden ist zwischen Gedichtverlauf und Erkenntnisprozess – sie demonstrieren beides gleichermaßen.
Der Sinn des Gedichts: das Verstehen zu verstehen, wäre dann nicht nur Resultat, sondern zeigte sich bereits in Machart und Form – wohlgemerkt zwangsläufig und nicht etwa, weil der Autor es im Schilde führte. Im Idealfall – und jetzt wird es noch verschwurbelter: verstünde sich so das experimentelle Gedicht selbst, und auch wenn ich nicht genau weiß, was das bedeutet, scheint es mir doch die Sache ganz gut zu beschreiben.Hinter dem sich selbst verstehenden Gedicht lauert natürlich auch das sich selbst schreibende Gedicht, und wir sind bei der Instanz des Autors gelandet. Bei Renate Kühn klang das Problem schon an, als Verlust des „privilegierten Status als autonomer Schöpfergott“.
Nun ist die Erfahrung des „Es schreibt“ für jeden Lyriker eine so existentielle Gegebenheit, dass ich hier keine großen Differenzen sehe. Selbst die Installierung eines „Lyrischen Ichs“ kann und soll diese Tatsache nicht überdecken. Abgesehen davon, dass „Ich“ und Autor natürlich verschiedene Entitäten sind, scheint das „Ich“ eine Autorschaft allerdings nahe zu legen, andererseits fiktionalisiert es sie so stark, dass man mit dem gleichen Recht sagen könnte, das „Ich“ im Gedicht problematisiere die Autorschaft oder hebe sie auf. Überhaupt ist das „Ich“-Verbot, wie die meisten anderen Verbote auch, natürlich dem doktrinären Gestus geschuldet und wird hiermit (liberal und doktrinär zugleich) in aller Form aufgehoben. Und von Ferne grüßen die Konzepte der radikalen Selbstentblößung, die ja auch einmal ein wichtiger avantgardistischer Topos war.“
__________________________________
__________________________________
(…)
was nämlich sache ist
(um letzte zweifel auszuräumen): nicht nicht zu
unterlassen. nicht zu vergessen: vergessen. zu
hungern. es schlichtweg verrichtet. nähme sich vor:
zu schneiden das brot. vergißt es. wird nun (das
brot wird immer härter) zu schneiden nennen „sägen“
sein? sei eure rede bestenfalls ja ja / nein nein!
was ähnlich schwer zu klären ist: ob es vielleicht
wahrscheinlich gibt. tendenz: vielleicht. wahrscheinlich nicht. doch damit steht man schnell allein. kommt also
nicht umhin „unding schlechthin“ als haben ding zu gelten
lassen. das brotlose des unterfangens: nicht nur nicht
nicht zu sagen / un zu tun. dann seine schönheit aber auch.
[fachsprachen IV/2/52]